März
24
Die Prinzessin mit dem Bart
Kategorie: Allgemein
Ein richtiger Prinz kann nicht nur fechten und Bogenschießen. Er kann auch schwierige Probleme lösen und Menschen helfen, besser miteinander auszukommen. Und er kann auch einen Prinzen lieben. Und eine Prinzessin mit Bart kann Prinzen- und Prinzessinnendinge tun. Martin Auer erzählt mit Witz und Ironie die Geschichte vom Prinzen Adelmut, der sich in Prinzessin Adelmute verwandelt, um sein Recht auf Liebe durchzusetzen.
Das Buch zum Video gibt es hier.
März
24
Okt.
23
Die Geschichte
Kategorie: Allgemein
Es waren einmal drei Brüder, die zogen hinaus in die Welt. Der Vater war gestorben, das Haus musste verkauft werden, damit das Begräbnis bezahlt werden konnte, und danach blieb nichts mehr übrig. Am zweiten Tag ihrer Wanderschaft hatten die drei nur noch Brot für eine Mahlzeit. Da sagten sie: „Wir gehen bis zum nächsten Brunnen. Wenn wir dort unser Brot essen, können wir Wasser dazu trinken.“
Als sie zu einem Brunnen kamen, schöpften sie Wasser, tranken es und aßen ihr letztes Stück Brot dazu. „Ach, wenn wir doch nur eine Hilfe hätten!“ seufzten sie.
Der Brunnen war aber ein Wunschbrunnen, denn es wohnte eine Wasserfee darinnen. Die kam zur Oberfläche und sagte zu den Brüdern: „Ich habe eure Seufzer gehört, und ich bringe euch eine Hilfe, wenn ihr sie zu nützen versteht. Drei Geschenke habe ich für euch: einen Geldbeutel, der nie leer wird, aber man darf nie die letzte Münze ausgeben, ein Brot, das nie alle wird, aber man darf nie das letzte Stück aufessen; und eine Geschichte, die nie zu Ende geht, aber man darf nie das Wort Tod aussprechen. Soll sich ein jeder von euch sein Geschenk auswählen.“
Da sagte der älteste Bruder: „Wir werden dem Alter nach wählen, ich zuerst“, und wählte den Geldbeutel. Danach wählte der zweite und nahm das Brot. Für den jüngsten blieb die Geschichte.
Und tatsächlich, die Wunschdinge hielten, was die Fee versprochen hatte. Der Geldbeutel, den der Älteste sich erwählt hatte, war jeden Morgen randvoll mit Goldstücken und Banknoten. Und wenn am Abend auch nur noch eine einzige Münze drin war, so war er doch am nächsten Morgen wieder gefüllt. Der älteste Bruder sagte zu den beiden anderen: „Nun, ich bin euch eigentlich nichts schuldig, aber greift nur jeder einmal tüchtig hinein in den Geldbeutel. Dann aber adieu! Ich habe meine eigenen Pläne, und wir müssen uns trennen.“
Er verließ seine beiden Brüder und ließ den Geldbeutel für sich sorgen. Freilich, nach einem Jahr oder zweien geschah es ihm einmal, dass er in einem Wirtshaus trank und alle anderen Gäste einlud, auf seine Kosten mitzutrinken. Und es waren viele Gäste da an jenem Abend, und sie waren fröhlich und ließen den edlen Spender hochleben. Aber als es ans Zahlen ging, machte die Zeche gerade so viel aus, wie der älteste Bruder in seinem Beutel hatte, und der Wirt ließ sich nicht bereden, auch nur einen Groschen bis zum nächsten Morgen zu borgen. Da füllte sich der Beutel nun nicht mehr.
Das war freilich für den ältesten Bruder nicht gar so schlimm; denn er hatte schon längst mit dem vielen Geld aus seinem Beutel ein gutgehendes Geldverleihergeschäft aufgemacht und besaß ein dickes Bankkonto und mehrere Häuser und Werkstätten.
Der zweite Bruder wurde ein berühmter Seefahrer und Erforscher fremder Kontinente. Denn mit seinem Brot, das niemals alle wurde, hatte er keine Proviantsorgen und konnte die entferntesten Inseln ansteuern und sich in die tiefsten Wälder und die weitesten Wüsten wagen. Behielt er am Abend auch nur ein Bröselchen von dem Brot über, so war daraus am Morgen doch wieder ein schwerer Laib geworden, der ihn und seine Mannschaft satt machte. Eines Tages freilich wurde dem zweiten Bruder bei einem Gastmahl auf einer der Inseln, die er entdeckt hatte, ein Braten serviert, und der Bratensaft schmeckte ihm so gut, dass er gedankenlos alles mit seinem Brot auftunkte und auch das letzte Stück mit aufaß. So war auch das Brot dahin.
Aber da war der zweite Bruder schon alt und Besitzer von mehreren Inseln und einer ganzen Flotte von Handelsschiffen, die für ihn auf allen Weltmeeren Handel trieben.
Auch dem dritten Bruder hatte die Fee nicht zuviel versprochen. In seinem Kopf begann sich eine Geschichte zu formen. Er ging noch bis in die nächste Stadt, borgte sich dort von einem Krämer auf dem Marktplatz einen Stuhl, setzte sich neben den Stadtbrunnen und begann seine Geschichte zu erzählen.
Die Geschichte begann mit einem Bauernburschen, der in die Welt zog und ein großer Held wurde. Als von allen seinen Abenteuern erzählt war, von all seinen Siegen und Niederlagen, von dem großen Opfer, das er gebracht hatte, und dem feigen Verrat, den er erst so spät gesühnt hatte, als von seiner großen Liebe erzählt war und seinem großen Schmerz, von seiner langen Herrschaft über ein mächtiges Reich und von seinem seltsamen, einsamen Ende, da ging die Geschichte weiter mit den Ereignissen um das Zauberschwert, das dieser Bauernbursch einst von einer mächtigen Fee erhalten hatte, und von dem Fluch, der darauf lastete. Und es wurde von allen Heldentaten und Gemeinheiten erzählt, die mit diesem Schwert begangen wurden, von den Listen derer, die sich in seinen Besitz setzen wollten, von den Schicksalen derer, die es bekamen, und den Schicksalen derer, die durch es umkamen. Und als von allen Abenteuern um das Schwert erzählt war, von dem letzten Frevel, der mit ihm begangen wurde, und wie es dann schließlich zerbrach und zu Staub wurde, als alles das erzählt war, da ging die Geschichte weiter mit der Historie aller Reiche, die mit diesem Schwert gegründet, erobert oder vernichtet worden waren, mit den Kriegen, die sie untereinander führten, und den Bündnissen, die sie miteinander schlossen. Und als von den Geschicken all dieser Reiche erzählt war und auch vom Untergang des letzten unter ihnen, da ging die Geschichte weiter mit den Erlebnissen des Fuchses, der im letzten dieser Reiche das letzte Huhn gestohlen hatte und dann ausgewandert war. Und es wurde erzählt von allen Bosheiten, die er beging, und von allen Fallen, denen er entkam, wie er den Wolf und den Bären betrog und die Gänse hereinlegte. Und als erzählt war, wie er schließlich doch von einer Maus hintergangen worden und einem Jäger in die Falle geraten war, da ging die Geschichte weiter mit den Ereignissen um den Mantel, dem der Fuchs nun als Kragen diente. Es wurde erzählt von dem Bischof, der den Mantel als erster besaß, von seinem schlechten Lebenswandel, über den sich die ganze Stadt empörte, und seinen heimlichen guten Taten, für die er sich so verschuldete, dass er den Mantel, so wie fast alles andere, was er besaß, einem Kaufmann, von dem er geborgt hatte, überlassen musste. Es wurde von dem tollpatschigen Kaufmann erzählt und seinem ewigen Streit mit seiner knurrigen Magd, die ihm dann doch immer aus der Patsche helfen musste und dann ihren Zorn mit dem Teppichklopfer an dem unschuldigen Mantel ausließ. Es wurde erzählt, wie der Mantel schließlich ausgedient hatte und zum Putzfetzen degradiert wurde und danach doch noch an eine Bettlerin kam, die ihn wieder trug, stinkend und verschmiert, wie er war, einen ganzen, bitteren Winter lang. Und als der Mantel endgültig ausgedient hatte und kein Faden mehr von ihm übrig war, da ging die Geschichte weiter mit dem Leben des Kindes, das unter diesem Mantel in einer eisigen Nacht geboren worden war. Und es wurde erzählt von dem Geschlecht, das aus diesem Kind der Bettlerin hervorging, einem Geschlecht von Mägden und Taglöhnern, Soldaten und Jahrmarktsgauklern, Dieben und Wahrsagerinnen, aus dem schließlich ein berühmter Soldat hervorging, der später Feldherr und schließlich Kaiser wurde. Und es wurde die Historie seines Reiches erzählt, bis auch dieses unterging: an der Rattenplage. Und als vom Zerfall dieses Reiches erzählt war, da ging die Geschichte weiter mit dem Leben der Ratte, die im Keller des Palasts des letzten Kaisers gehaust hatte, und mit dem Floh, den diese Ratte hatte. Und es wurde erzählt von allen Menschen, die dieser Floh biss, und von ihrem schrecklichen Ende; denn die Ratte und der Floh, die trugen die Pest in die Welt. Und es wurde erzählt, wie die Pest sich verbreitete und wuchs und die Länder entvölkerte; es wurde erzählt, wie die Menschen Furcht voreinander bekamen und voreinander flohen und einander verrecken ließen aus Angst vor der Ansteckung, und es wurde erzählt von dem Erbarmen, das die Menschen miteinander hatten, von der Liebe, die das Unglück in ihnen weckte, von der Hilfe und den Opfern, die sie einander brachten, von der Weisheit und der Torheit, die die Nähe des Untergangs in den Menschen weckte. Und es wurde erzählt von einem Dorf, in dem alle umkamen und nur ein einziges Mädchen verschont blieb. Und als vom Ende der Pest erzählt war und von dem Aufatmen und dem Neuanfang in allen Ländern, da ging die Geschichte weiter mit dem Leben dieses Mädchens, und es wurde erzählt von ihrer Wanderung durch das leere Land, bis sie wieder zu Menschen fand, und wie sie nie wieder solche Einsamkeit erleben und in Zukunft nur noch für die Liebe leben wollte. Und es wurde erzählt von all den schönen Burschen, denen sie um den Hals fiel, und von allen ihren Liebhabern, die sie in lauen Sommernächten besuchten. Und es wurde erzählt, wie sie ihrem letzten Liebhaber, als der sie verlassen wollte, eine Buchecker schenkte, mit der Bitte, sie dort zu pflanzen, wo er sich ein Haus bauen würde. Und die Geschichte ging weiter mit dem Leben des Baums, der aus dieser Buchecker wuchs; es wurde erzählt, wie er seine Wurzeln in die Erde und seine Äste in die Höhe reckte, wie er gedieh und Frucht trug und aus seinen Früchten ein Wald wurde, der schließlich das Haus des ungetreuen Liebhabers überwucherte. Und so ging die Geschichte immer weiter und weiter, und der jüngste Bruder saß jahraus, jahrein auf seinem Stuhl neben dem Brunnen und erzählte, und der Marktplatz war voll von Leuten, die von weit her gekommen waren, um ihm zu lauschen.
Die weiter vorne standen, erzählten im Flüsterton denen, die hinten standen, was sie hörten, und die, die abreisen mussten, erzählten, was sie gehört hatten, dort, wo sie hinkamen, und warteten selber begierig auf solche, die später nachkamen und erzählen konnten, wie die Geschichte weiterging.
In den Wintern wurde ein Zeltdach über dem Marktplatz aufgespannt und auch in den Sommern, wenn es regnete. Aber der jüngste Bruder saß da und erzählte, in seine Geschichte versunken, und hätte nicht Hagel noch Frost verspürt. Die ihm zuhören kamen, brachten ihm viele Geschenke, Essen und Kleider, und abends, wenn er müde war, führte man ihn in ein prächtiges Haus, das ihm ein reicher Bewunderer überlassen hatte. Er freilich merkte kaum, wo er schlief und was er aß, denn sein Geist war tief in seiner Geschichte. Immer horchte er in sich hinein, horchte und lauschte auf die Geschichte, die in ihm wuchs und sich ausbreitete, die ihn erfüllte und mit sich forttrug, die sich ihm auftat wie eine erblühende Knospe, von der die äußeren Blätter ständig abfielen, während im Innern sich immer neue Blätter entfalteten. Und aus seinen Augen, die kaum sahen, was um ihn herum vorging, aus seinem abgemagerten, alt gewordenen Gesicht leuchtete ein Staunen, ein verwundertes Sinnen über all das, was sich in seinem Innern begab.
Nie aber erwähnte er in seiner Geschichte das Wort, das die Fee ihm verboten hatte. Wenn der Beender alles Lebens vorkam in seiner Geschichte, dann nannte er ihn den Sensenmann oder Freund Hein; er sagte, dass seinem Helden nun das letzte Stündlein schlug, dass er den letzten Atemzug tat oder das Zeitliche segnete.
Und seine Geschichte ging immer weiter. Einmal war es die Geschichte einer Frau, dann die eines Mannes, eines Tieres oder einer Blume, eines Landes oder einer Insel, eines Meeres oder eines Wassertropfens, aber immer war es dieselbe Geschichte.
Eines Tages drängte sich ein hübsches kleines Mädchen durch die Menge, das trug eine kleine weiße Blume vor sich her, um sie dem Geschichtenerzähler zu bringen. Da wandte sich nach langen Jahren sein Blick wieder nach außen. Er hielt in seiner Geschichte inne und sah ihr aufmerksam entgegen. „Siehe“, sagte er, „das ist mein Tod.“
Und da war auch diese Geschichte zu Ende.
Sep.
3
Amanda und die Monster
Kategorie: Allgemein
Amanda kann nicht schlafen gehen, weil Monster in ihrem Zimmer sind. Aber dann gibt es eine Überraschung…

Jan.
10

„Und, was soll das nun sein, dieses Geld?“ Der alte Kitunda drehte das kleine Papierstück zwischen seinen Fingern.
„Es ist etwas, was die Fremden sehr schätzen“, sagte sein Sohn. „Der Agent sagt, wenn man viele, viele dieser Papierstücke hat, dann gilt man als ein reicher Mann.“
„Das kommt mir ziemlich dumm vor“, sagte der alte Kitunda. „Wenn man viele Kühe hat und viele Felder mit Mais und Yam, ein hübsches Haus und viele Kinder – dann ist man reich. Wozu soll ein Haufen Papierstücke gut sein? Kann man Papier essen? Kann man es anziehen oder darin wohnen?“
„Nun, der Agent sagt, dass man es in alles verwandeln kann. Man kann es in ein Haus verwandeln oder in eine Kuh oder in schöne Kleider, wie sie die Fremden tragen.“
„Dann ist es etwas Magisches?“
„Nein. Man kann einfach diese Papierstück gegen alles eintauschen, was man will. Wenn du ein schönes Haus siehst, kannst du dem Besitzer einige Papierstücke anbieten und ihn bitten, es dir zu überlassen. Wenn er dir das Haus nicht geben will, bietest du ihm mehr Papierstücke an. Irgendwann wird er dir das Haus geben, wenn du ihm bloß genug Papierstücke dafür bietest. Zumindest hat es mir der Agent so erklärt.“
„Dann muss es wirklich sehr starke Magie sein. Vielleicht macht die Magie, dass der Besitzer des Hauses die Fähigkeit verliert, klar zu denken?“
„Nein, das ist es nicht. Der Besitzer des Hauses kann das Geld wieder für etwas anderes eintauschen. Vielleicht für eins von diesen Autos, mit denen die Fremden fahren, oder für ganz viel Essen oder für ein anderes Haus. Deswegen lässt er dir sein Haus im Tausch für das Geld. Mit dem Geld kann er woanders hingehen und ein Haus kaufen und dort wohnen. Du kannst ein Haus nicht mit dir tragen.“
„Aber wenn er auch dumm genug ist ein Haus für Papierstücke herzugeben, wie kann er wissen dass er jemanden anderen findet, der genau so dumm ist und wertvolle Dinge für Papierstücke hergibt?“
„Ich weiß es wirklich nicht, Vater. Aber der Agent sagt, jeder weiß, dass Geld wertvoll ist und deshalb sind alle bereit, Dinge für Geld herzugeben.“
Der alte Kitunda schüttelte den Kopf. „Und der Agent, er hat dir dieses Geld gegeben?“
„Ja. Er hat mir gesagt, ich sollte zurück ins Dorf kommen und allen jungen Männern sagen, dass sie auf der Baumwollplantage arbeiten sollen. Und dafür hat er mir Geld gegeben. Und er hat gesagt, für jeden Mann, der kommt, um zu arbeiten, wird er mir mehr Geld geben.“
„Er will also, dass die Männer auf der Plantage für ihn arbeiten und dafür will er ihnen Geld geben?“
„Nun, die Plantage gehört ihm nicht. Sie gehört seinem Boss. Und sein Boss wird uns das Geld geben.“
„Sie wollen also, dass ihr geht und Baumwolle pflückt für wertlose Papierfetzen. Und wer wird sich um deine Kühe kümmern? Wer wird auf deinen Feldern arbeiten und den Mais und die Yamwurzeln ernten?“
„Der Agent sagt, mit dem Geld, das uns sein Boss geben wird, können wir mehr Mais und Yams kaufen als wir von unseren Feldern ernten.“
„Und was ist, wenn er lügt? Wie könnt ihr wissen, wieviel so ein Stück Papier wirklich wert ist?“
„Ich weiß es nicht, Vater.“
Der alte Mann grübelte eine Weile. „Wenn du mit jemandem Handel treibst, musst du wissen, was das Ding wert ist, das du hergibst, und was das Ding wert ist, das du bekommst. Du kennst doch die Waldleute. Sie pflanzen keinen Mais und keine Yams an. Stattdessen bringen sie uns getrocknetes Fleisch und wilden Honig aus dem Wald und wir tauschen das ein für Mais und Yams. Du weißt, was der alte Ekianga sagt, wenn er glaubt, dass ich ihm zu wenig Mais für sein Fleisch anbiete. Er sagt: ‚Ach, schau doch, ich habe so lange gebraucht um diese Antilope zu jagen. Wenn du mir so wenig Mais dafür gibst, lohnt es sich für mich nicht für dich zu jagen. Da wäre ich besser dran, wen ich mein eigenes Feld anlegen würde!’ Aber wenn er zuviel Mais verlangt, dann sage ich zu ihm: ‚Ach, komm, es ist so viel Arbeit, das Feld zu hacken und den Mais zu bewässern und zu ernten und zu trocknen. Wenn du mir so wenig Fleisch für den Mais gibst, dann geh ich doch lieber selber in den Wald zum Jagen!’
Kitundas Sohn lachte: „Ich weiß, wie ihr zwei immer schachert.“
„Und es stimmt auch. Wenn wir sehen, dass die Waldleute zu fett werden, dann wissen wir, dass wir ihnen zu viel Mais für ihr Fleisch geben, und wenn sie meinen, dass wir zu fett werden, dann wissen sie, dass sie uns zu viel Fleisch für unseren Mais geben. Du siehst, im großen und ganzen gleicht es sich aus und wir tauschen eine Tagesarbeit im Feld gegen eine Tagesarbeit im Wald aus. Aber mit diesem Geld – ich weiß gar nicht, wie es gemacht wird und ich kenne den Mann nicht, der es herstellt. Wie sollte ich wissen, oder auch nur erraten, wieviele Stücke Papier man an einem Tag machen kann?“
„Dasselbe habe ich den Agenten auch gefragt. Er hat gesagt, dass die Banknoten in der großen Stadt von Maschinen gemacht werden und dass sie in einer Stunde viele Tausend machen können.“
„Wenn sie so viele in so kurzer Zeit machen können, dann sind diese Papierstücke überhaupt nichts wert. Nicht einmal ein einziges Maiskorn! Hör auf mich, mein Sohn: Geh nicht auf die Plantage arbeiten. Arbeite auf deinen eigenen Feldern, und dir und deiner Familie wird es gut gehen. Ihr werden viel zu essen haben und alle werden sehen, dass du ein wohlhabender Mann bist und sie werden dich achten und respektieren.“
Kitundas Sohn sagte: „Ich werde es mir überlegen, Vater.“
Kitundas Sohn besuchte seinen Nachbarn und zeigte ihm das Geld, das der Agent ihm gegeben hatte: „Da, schau dir das an. Die Fremden nennen das Geld. Was gibst du mir dafür?“
Der Nachbar lachte: „Dafür? Gar nichts. Wenn ich so etwas brauche, dann pflücke ich ein Blatt vom nächsten Busch. Du weißt schon, wofür…“
Also ging Kitundas Sohn zu seinem anderen Nachbarn: „Hör zu, meiner Frau ist das Salz ausgegangen. Kannst du mir etwas Salz geben? Ich gebe dir dieses Geld dafür.“
Der andere Nachbar sagte: „Schau, ich gebe dir gern etwas Salz, weil wir Freunde sind. Du kannst es mir zurückgeben, sobald du kannst, oder du kannst mir ein paar Kassavawurzeln dafür geben. Aber was soll ich mit diesen Papierstücken?“
„Nun, die Fremden würden es dir für irgendetwas, was du brauchst, eintauschen. Für ein bisschen Zucker zum Beispiel oder für ein hübsches Stück Baumwollstoff.“
„Ich habe so etwas gehört, ja. Aber ich traue dieser Sache nicht. Schau, wenn ich eine Ziege habe, weiß ich, dass ich sie immer für irgend etwas anderes eintauschen kann, denn jeder Mensch braucht Milch und muss gelegentlich ein Stück Fleisch essen. Aber wer garantiert mir, dass ich jemanden finder, der Papierstücke braucht?“
Kitundas Sohn ging durchs ganze Dorf aber niemand wollte für sein Geld etwas eintauschen und niemand wollte mit ihm zur Plantage gehen um dort zu arbeiten. Also ging er auch nicht dorthin sondern bearbeitete seine eigenen Felder, wie es sein Vater und sein Großvater getan hatten, und seine Frau und seine Kinder waren gesund und wohlgenährt und er wurde von den anderen Dorfbewohnern geachtet.
In der Stadt an der Küste, wo die Schiffe der Fremden die Güter entluden, die die Fremden den Einwohnern verkaufen wollten, und die Baumwolle und das Kupfer und die Diamanten einluden, die die Fremden in ihrem Land jenseits des Meeres brauchten, rief der Gouverneur seine Berater zu einer Besprechung zusammen.
„Wir haben Probleme“, erklärte er. „Der Handel mit dem Mutterland läuft nicht so gut, wie er sollte. Dieses Land ist ideal für die Baumwollzucht, es ist voll von Kupfer und Diamanten. Aber wir können nicht genug Arbeiter für die Minen und Baumwollfarmen finden.“
„Und wo liegt der Grund dafür?“ fragte der Präsident der Handelskammer. „Es leben hier so viele Menschen. Was machen die den ganzen Tag?“
„Es scheint, dass sie damit zufrieden sind auf ihren eigenen Feldern zu arbeiten, ein bisschen Mais und Bananen anzupflanzen und ein paar Kühe und Ziegen zu halten“, sagte der Vorsitzende des Landwirtschaftsauschusses.
„Sie sind nichts als ein Haufen Faulpelze“, sagte der Kommandeur der Kolonialtruppe. „Wir sollten einfach Zwangsarbeit einführen!“
„Hmm, nun ja. Das Problem scheint zu sein, dass sie einfach nicht daran interessiert sind, für Geld zu arbeiten“, sagte der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses.
„Und warum glauben Sie, dass sie nicht an Lohnarbeit interessiert sind?“ fragte der Präsident der Handelskammer.
„Weil sie das Prinzip des Geldes nicht verstehen. Sie glauben, dass es nur wertlose Papierstücke sind.“
„Nun ja, es sind wertlose Papierstücke“, sagte der Präsident der Handelskammer lachend. „Ich wundere mich manchmal selber, wie das funktioniert. Ich wette, die Leute hier messen ihr Vermögen noch immer in Kühen und Ziegen.“
„So ist es“, sagte der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses.
„Auf gewissen Weise haben sie ja recht. Bei Kühen weiß man, woran man ist. Man kann immer jemanden findern, der Fleisch essen oder Milch trinken will, und wenn man die Kuh nicht eintauschen kann, kann man sie immer noch selber essen. Bei Gold ist es auch so, man kann es als Schmuck tragen oder sich falsche Zähne daraus machen lassen. Aber wir können die Leute natürlich nicht in Kühen bezahlen. Wissen Sie, als ich auf der Universität war, hat uns unser Professor gesagt: „Alles kann Geld sein, wenn die Menschen glauben, dass es Geld ist.“
„Und was können wir also tun, damit sie glauben dass unser Geld Geld ist?“ fragte der Gouverneur.
Der Präsident der Handelskammer überlegte: „Die jungen Männer wollen nicht für Geld arbeiten, weil die Bauern ihnen für das Geld kein Essen geben. Und die Bauern nehmen das Geld nicht an, weil die Handwirker ihnen für das Geld keine Töpfe und Hacken geben. Und so weiter…“
„Dann brauchen wir ein Gesetz, das sie zwingt Geld anzunehmen wenn jemand etwas kaufen will“, sagte der Kommandeur der Kolonialtruppen.
„Das ist nicht so leicht“, sagte der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses. „Sie würden ihre Waren bloß verstecken und sagen, dass sie nichts zu verkaufen haben. Wir wissen, dass das in anderen Ländern passiert ist. Wir können ja nicht jeden die ganze Zeit kontrollieren. Nein, wir müssen sie irgendwie überzeugen, dass sie Geld brauchen, dass der Handel und die Wirtschaft ohne Geld nicht blühen können.“
„Es sollte nicht so schwer sein, sie zu überzeugen“. Der Vorstand des Finanzausschusses sprach zum ersten Mal.
„Und wie soll das gehen?“ fragte der Gouverneur?
„Wir können sie zwar nicht zwingen, Geld anzunehmen, aber wir können sie zwingen, uns Geld zu geben. Wir verlangen, dass jeder jedes Jahr eine gewisse Summe als Steuer zahlen muss. Es ist leicht zu kontrollieren, ob jemand einmal im Jahr seine Steuer bezahlt hat. Und die Steuer muss in unserem Papiergeld bezahlt werden. So werden alle genötigt sein, sich irgendwie dieses Geld zu beschaffen. Und sie werden bereit sein, für Geld zu arbeiten und Waren gegen Geld einzutauschen. Wir werden die Arbeiter haben, die wir brauchen, und werden ihnen unsere Waren verkaufen können.“
„Ein großartiger Gedanke!“ sagte der Gouverneur, und der Präsident der Handelskammer und der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses klatschten Beifall.
„Und wenn sie nicht zahlen, marschieren sie in Gefängnis“ fügte der Kommandeur der Kolonialtruppen hinzu, und dieses Mal applaudierten die anderen auch ihm.
„Also“, sagte der alte Kitunda, „jetze haben sie uns da, wo sie uns wollten!“
Die jungen Männer waren bereit, zur Plantage aufzubrechen.
„Mach dir keine Sorgen, Vater“, sagte Kitundas Sohn. „Ich werde das Geld verdienen um die Steuer für dich und für Mutter und für meine Frau zu bezahlen. Unserer Familie wird nichts passieren.“
„Ja. Aber unserer Felder werden brachliegen, weil uns eure starken Arme fehlen werden. Wir werden niemals mehr selber für uns sorgen können, wir werden vom Geld der Fremden abhängig sein und davon, ob sie uns für sich arbeiten lassen oder nicht.“
Der alte Kintunda umarmte seinen Sohn. „Ich hoffe, dass ich noch am Leben sein werde, wenn du von der Plantage zurückkommst, damit ich dich begrüßen kann. Aber vielleicht mag ich auch gar nicht mehr länger leben. Weißt du, als sie das erste Mal hier auftauchten, wollten einige von uns gegen sie kämpfen. Aber erst jetzt haben sie uns wirklich besiegt. Nichts wird mehr so sein wie früher.“
Und die jungen Männer marschierten davon.
Dez.
20
Der rote Ballon
Kategorie: Allgemein
Als der kleine Fritz in seinem großen roten Ballon beim Schloss des Zauberers landete, waren da viele tausend Kinder, die der böse Zauberer in der ganzen Welt geraubt hatte. Der kleine Fritz rief sie zusammen und verkündete: „Der böse Zauberer ist tot! Er hat sich zu weit aus dem Ballon gebeugt und ist hinuntergefallen!“
„Hurra!“ riefen die Kinder.
„Der rote Ballon hat mich hierher gebracht und ich bin gekommen, um euch zu retten!“
„Hurra!“ riefen die Kinder.
„Ich werde euch alle in meinem roten Ballon nach Hause bringen, damit ihr wieder bei euren Eltern wohnen und mit euren Freunden spielen und wieder in die Schule gehen könnt! Der rote Ballon wird ein jedes von euch genau an den Ort bringen, wo der böse Zauberer euch gefangen hat!“
„Hurra!“ riefen die Kinder. Aber es klang nicht mehr so laut. Und nicht mehr so fröhlich. Denn: Nicht alle Kinder hatten gerufen.
„Was ist los mit dir?“ fragte der kleine Fritz ein Mädchen. „Freust du dich nicht darauf, deine Eltern wiederzusehen?“
„Ich wohne nicht bei meinen Eltern“, sagte das Mädchen. „Ich lebe bei meiner Tante. Meine Mutter ist in ein fremdes Land gezogen und arbeitet dort als Dienstmädchen. Sie macht bei reichen Leuten das Haus sauber. Und mein Vater ist in ein anderes Land gezogen und baut dort Straßen. Sie kommen nur einmal im Jahr nach Hause. Meine Tante verkauft auf dem Markt Gemüse und nach der Schule muss ich auf ihre kleinen Kinder aufpassen.“
„Und was ist mit dir?“ fragte der kleine Fritz einen Jungen. „Wohnst du auch nicht bei deinen Eltern?“
„Doch“, sagte der Bub. „Ich wohne bei meinen Eltern. Aber ich kann nicht in die Schule gehen. Ich muss meinen Eltern beim Orangenpflücken helfen. Alle Kinder müssen mithelfen, damit wir genug Geld verdienen. Wenn meine Brüder und Schwestern und ich nicht mithelfen würden, würden meine Eltern nicht genug Geld verdienen, um für uns alle Essen zu kaufen und den Arzt zu bezahlen, wenn jemand krank wird.“
„Und was ist mit dir?“ fragte der kleine Fritz ein Mädchen, das auch nicht sehr glücklich zu sein schien. „Musst du auch mitarbeiten, damit deine Eltern genug verdienen?“
„Nein“, sagte das Mädchen. „Ich helfe meiner Mutter und meiner Tante im Haus. Aber da, wo ich herkomme, schickt man nur die Buben in die Schule. Mädchen müssen zu Hause bleiben und Kochen und Putzen und Nähen lernen und wie man auf kleine Kinder aufpasst. Später muss ich den Mann heiraten, den meine Eltern mir aussuchen werden. Ich würde gerne in die Schule gehen und lernen und später vielleicht Krankenschwester werden, aber das wird immer ein Traum bleiben.“
„Und du?“ fragte der kleine Fritz ein anderes Mädchen. „Warum freust du dich nicht, nach Hause zu kommen?“
„Wir haben kein Zuhause mehr. Eines Tages hat es im Radio geheißen, dass feindliche Soldaten sich unserer Stadt nähern, und wir mussten fliehen. Zwei Jahre lang habe wir in einem Lager gelebt mit einer Plastikplane als Dach überm Kopf und haben nichts zu tun gehabt. Dort bekommen wir jeden Tag ein bisschen Reis zu essen, aber wir müssen uns stundenlang anstellen dafür, und dann müssen wir uns wieder bei der Wasserpumpe anstellen um eine Kanne voll Wasser. Es gibt keine Arbeit für die Erwachsenen und keine Schule für die Kinder.
„Und was ist mit dir?“ fragte Fritz einen Jungen.
„Meine Eltern sind im Krieg getötet worden. Wenn der Ballon mich zurückbringt, weiß ich nicht, wo ich hin soll. Ich habe Angst, dass die Soldaten kommen und ich mit ihnen gehen und kämpfen muss. Und ich weiß gar nicht, gegen wen sie kämpfen und warum.“
Und so ging es weiter:
„Ich werde froh sein, meine Eltern wiederzusehen und mit ihnen die Kühe zu hüten. Aber unser Lehrer ist aus dem Dorf weggezogen um in den Kohlengruben zu arbeiten, weil die Regierung sein Gehalt nicht geschickt hat.“
„Das Erdbeben hat die Schule in unserem Dorf zerstört und sie ist nicht wieder aufgebaut worden.“
„Wir haben eine Schule in unserem Dorf, aber meine Eltern haben nicht genug Geld, um Bücher und Stifte zu kaufen, und darum kann ich nicht in die Schule gehen.“
„Meine zwei Schwestern und ich haben zusammen nur ein paar Schuhe. Deshalb kann immer nur eine von uns in die Schule gehen und die zwei anderen müssen zu Hause bleiben, denn da, wo ich wohne, ist es sehr kalt.“
„Meine Eltern hatten nicht genug Essen und Kleider für mich und meine Brüder. Da bin ich von zu Hause weggelaufen, damit sie es leichter haben. Wenn der Ballon mich zurückbringt, werde ich wieder betteln müssen und in der Nacht in einem Kanalrohr schlafen.“
„Ich gehe jeden Tag zwei Stunden zu Fuß, um für meine Familie Wasser zu holen. Und drei Stunden, um Brennholz zu suchen. Meine jüngeren Geschwister gehen in die Schule, aber meine Mutter braucht mich zu Hause, weil wir keinen Vater haben und ich die Älteste bin.“
„Ich weiß nicht, wer meine Eltern sind. Ich fahre mit den Eisenbahnzügen herum und sammle die Wasserflaschen, die die Leute liegen lassen. Ich mache sie sauber und fülle sie wieder mit Wasser an und verkaufe sie den Leuten im Zug. Die Hälfte von dem, was ich verdiene, muss ich dem Schaffner geben, damit er mich nicht aus dem Zug wirft.“
„Seit zwei Jahren hat es bei uns nicht geregnet. Wir können keinen Mais und kein Gemüse anpflanzen und wir mussten unsere letzte Kuh schlachten, weil wir sie nicht füttern konnten. Meine kleine Schwester ist krank geworden und gestorben, und meine Mutter sitzt nur da und starrt in die Luft, weil es nichts gibt, was sie tun kann!“
„Meine Eltern arbeiten auf der Baustelle. Ich helfe ihnen und schleppe Ziegel. Ich bin acht Jahre alt und kann acht Ziegelsteine auf dem Kopf tragen. Ich bin sehr stark und darauf bin ich stolz. Aber ich habe keine Zeit in die Schule zu gehen.“
„Ich möchte meine Eltern schon gern wiedersehen. Aber wo wir wohnen, müssen wir Wasser aus dem Fluss trinken, weil es keinen Brunnen gibt. Zwei von meinen kleinen Brüdern sind schon krank geworden und gestorben, weil das Flusswasser schmutzig ist.“
„Meine Familie und ich, wir wohnen auf einer Müllhalde am Stadtrand. Wir suchen nach Altmetall und Plastikflaschen und manchmal finden wir ein Radio oder sogar eine Waschmaschine, die man noch reparieren kann. Ich könnte nicht in die Schule gehen, sogar, wenn meine Eltern es erlauben würden, weil ich zu schmutzig bin und niemand neben mir sitzen wollen würde.“
„Meine Eltern sind aus dem Dorf in die Stadt gezogen, um Arbeit zu suchen. Wir schlafen auf einer Decke auf dem Gehsteig. Aber vielleicht haben meine Eltern inzwischen Arbeit gefunden. Sie haben mir versprochen, dass sie mich dann in die Schule schicken werden.“
„Meine Eltern konnten mir nicht genug zu essen geben. Also haben sie mich zu einer Familie als Dienstmädchen gegeben. Ich arbeite jeden Tag sechzehn Stunden und bekomme noch immer nicht genug zu essen. Warum sollte ich mich freuen, dorthin zurückzukommen, wo ich war?“
Der kleine Fritz war verzweifelt. Er fühlte sich gar nicht mehr als Held. Fast die Hälfte aller Kinder waren nicht wirklich froh darüber, dorthin zurückgebracht zu werden, wo sie hergekommen waren. Ihre Familien waren zu arm, um sie zu ernähren oder sie konnten nicht in die Schule gehen oder sie hatten kein sauberes Wasser zu trinken oder sie mussten hart arbeiten oder es gab keinen Arzt und kein Spital in ihrer Nähe oder sie hatten überhaupt keine Familie.
Die Kinder hatten sich in zwei Gruppen aufgeteilt: Die, die es gar nicht erwarten konnten, in den Ballon zu steigen und zu ihrem alten Leben zurückzukehren, und die, die fühlten, dass das Leben, das sie erwartete, nicht viel besser war als das, was sie jetzt hatten.
Da kam eines der Mädchen aus der glücklichen Gruppe herüber und nahm einen Jungen an der Hand und sagte: „Du kannst mit mir kommen und bei mir wohnen. Meine Eltern werden dir sicher Kleider und Essen geben. Dann musst du nicht mehr Orangen pflücken und wir können zusammen in die Schule gehen!“
„Danke!“ sagte der Junge. „Aber was ist mit meinen Brüdern und Schwestern? Und mit meinen Eltern? Können die auch kommen?“
Das Mädchen schaute zu Boden und zuckte hilflos die Schultern.
Da sagte ein Junge: „Bevor wir alle hier zusammengekommen sind, habe ich nicht gewusst, dass so viele Kinder unglücklich sind und in Armut leben. Wir müssen herausfinden, warum das so ist. Irgend etwas stimmt mit der Welt nicht. Vielleicht sollten wir alle zusammenbleiben. Alle sollen erzählen, wo sie herkommen und wie sie leben und was ihre Eltern tun, und vielleicht können wir herausfinden, was da nicht stimmt.“
Und ein größeres Mädchen sagte: „Ja, und wir müssen Bücher und Zeitungen lesen und herausfinden, wo die Schiffe mit den Nahrungsmitteln hinfahren und wo die Banknoten gedruckt werden und wie Bleistifte und Computer gemacht werden und wer den Lastwagenfahrern sagt, wo sie die Kleider und Schuhe abliefern sollen.“
Und ein Bub sagte: „Ja, bleiben wir zusammen und finden wir das alles heraus. Der böse Zauberer hat eine große Bibliothek mit Büchern aus der ganzen Welt gehabt. Vielleicht können wir dort anfangen!“
Und so wurde das beschlossen. Und ein Brief wurde geschrieben und der kleine Fritz wurde mit seinem roten Ballon ausgeschickt, um ihn an alle Eltern zu verteilen, und in dem Brief stand, dass die Kinder so lange nicht nach Hause kommen würden, bis sie herausgefunden hatten, was mit der Welt nicht stimmt und wie man die Dinge so einrichten kann, dass alle Kinder auf der Welt bei ihren Eltern leben und in die Schule gehen und mit ihren Freunden spielen können und sicher vor Hunger, Krankheit und Gewalt leben können.
Dez.
13
Das Wort Gottes
Kategorie: Allgemein
Als Gott der Herr einmal auf die Erde herunterschaute und sah, wie die Menschen sich plagten und abmühten und einander weh taten, da wollte er ihnen helfen. Er braute schnell eine Medizin zusammen, die jede Krankheit heilt außer dem Tod durch Altersschwäche und füllte sie in eine Flasche, die niemals leer wird. Aber der die Flasche fand, war ein Apotheker, der wusste gleich, was er daran hatte. Und obwohl die Flasche niemals leer wurde, verkaufte er die Medizin nur an die mächtigsten Herrscher und die reichsten Händler, und die mussten ihm für einen Tropfen so viel Gold geben, wie ein mittlerer Palast wert ist. Und als der Apotheker starb, da war er der reichste Mann der Welt, aber die Flasche hatte er so gut versteckt, dass sie niemand finden konnte.
Da dachte sich Gott der Herr, dass das wohl nicht das richtige gewesen war. Und er backte schnell ein Brot, das jeden satt macht und das nicht weniger wird, soviel man davon auch abschneidet. Jetzt können alle Menschen wenigstens satt werden, dachte er. Und er tat das Brot in einen Korb, den band er an eine Wolke und ließ das Brot so auf die Erde hinunter segeln. Aber der das Brot fand, war ein General, und der ernährte damit seine Armee, die unbesiegbar wurde, weil ihr niemals das Essen ausging. Und er eroberte ein Land nach dem anderen und machte sich zum König von all diesen Ländern. Doch in einer großen Schlacht, als die Armeen mit Kanonen und Flammenwerfern aufeinander schossen, da verbrannte das Brot. Und so war der Menschheit wieder nicht geholfen.
Da dachte sich Gott der Herr, ich muss es anders machen. Und er schrieb schnell ein kleines Buch, das hieß: „Wie man glücklich wird und lange lebt“, und darin stand alles, was die Menschen wissen sollten, um gut miteinander auszukommen und gesund zu bleiben. Und er ließ das Buch auf die Erde segeln. Da kam eine Gruppe junger Mönche vorbei, die waren gerade in der Ausbildung. Und als sie das Buch fanden und merkten, was es war, da wollte es jeder haben. Denn jeder dachte sich, mit dem Wort Gottes in der Hand könnte er ein großer Priester werden und die Menschen würden ihn verehren und vielleicht sogar nach seinem Tod zu einem Heiligen machen. Und so rauften sie sich um das Buch und dabei zerrissen sie es, und jeder, der einen kleinen Fetzen davon ergattern konnte, rannte damit davon in ein anderes Land. Aber mit so einem kleinen Fetzen vom Wort Gottes konnte man ja nicht vor die Leute treten. Und so musste ein jeder seinen kleinen Fetzen vom Wort Gottes irgendwie ausbessern und mit Wörtern und Sätzen und Kapiteln ausstopfen und aufblasen, bis wieder ein dickes Buch daraus geworden war, das man herzeigen konnte. Und damit es nach was aussah, ließen sie die Bücher in teures Leder binden und mit Edelsteinen verzieren und an den Ecken vergolden. Und jeder behauptete, dass nur sein Buch das wirkliche und wahrhaftige und einzige Wort Gottes enthalte und alle anderen erstunken und erlogen seien. Und natürlich ist es schwer, in diesen dicken Büchern das kleine Fetzchen vom Wort Gottes zu finden, das noch drin stecken mag. Und so gab es erst recht wieder Streit und Uneinigkeit und Gewalttätigkeiten unter den Menschen, und sie hauten einander nicht nur Knüppel und Schwerter und Bomben um die Ohren, sondern auch noch das Wort Gottes.
Und als Gott der Herr auf die Erde herunterschaute und sah, was sie mit seinem Wort gemacht hatten, das sagte er wohl, ach was, macht euch euren Kram jetzt einmal selber. Er wird ja auch sehr beschäftigt sein und noch andere Dinge zu tun haben und hat wahrscheinlich gerade keine Zeit, um eine Sintflut zu schicken.
März
11
Die Jagd nach dem Zauberstab
Kategorie: Allgemeines
Und wieder darf ich euch ein neues Hörbuch vorstellen, das bei audible.de erschienen ist. Es heißt: „Die Jagd nach dem Zauberstab“ und erzählt, wie Flo – eigentlich heißt sie ja Florentine – auf dem Dachboden einen Zauberstab findet – und zwar den allerletzten Zauberstab, den es gibt. Und so passiert, was Flo natürlich nicht wollte: Im Park verwandelt sie ein Kind in einen Hund. Und bevor Flo das Kind zurückverwandeln kann, entreißt ihr ein kleiner gelber Hund den Zauberstab und läuft davon. Flo saust hinterher – und so beginnt die turbulente Jagd nach dem Zauberstab!
Man kann dieses Hörbuch bei audible.de herunterladen. Der Download kostet € 11,95.
Sep.
14
Flunkerfisch
Kategorie: Allgemeines
Es lebte einst ein Fisch, und der hieß Florian Flunkerfisch.
Er sah nicht nach viel aus, grau und schuppig war er bloß.
Doch wenn er erst mal redete, dann gab’s auch was zu hören:
Denn Flunkerfisch war klein, doch seine Phantasie war groß.
Flunkerfisch von Julia Donaldson, übersetzt von Martin Auer, mit Bildern von Axel Scheffler, kann man bei amazon.de bestellen
.
Sep.
14
Der wunderbare Zauberer von Oz
Kategorie: Allgemeines
In dieser Folge darf ich euch mein Hörbuch „Der wunderbare Zauberer von Oz“ vorstellen, das bei audible.de erschienen ist. Es erzählt, wie die kleine Dorothy von einem Wirbelsturm aus Kansas in ein rätselhaftes Land gewirbelt wird. Hier ist alles anders. Nur der Zauberer von Oz, heißt es, kann Dorothy helfen. Aber wo wohnt dieser mächtige Zauberer? Mit dem Vogelscheuch, dem Blechernen Holzfäller und dem Ängstlichen Löwen besteht Dorothy viele Abenteuer auf dem Weg zur Smaragdenen Stadt, wo sich der Zauberer verbergen soll.
Das Hörbuch kann man bei audible.de als Download kaufen, es kostet €11,95.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




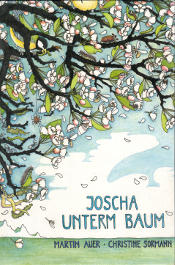 Joscha unterm Baum
Joscha unterm Baum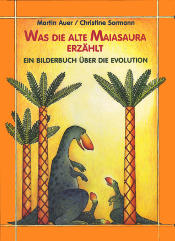



 Der seltsame Krieg
Der seltsame Krieg
 Lieblich klingt der Gartenschlauch - Lieder
Lieblich klingt der Gartenschlauch - Lieder




